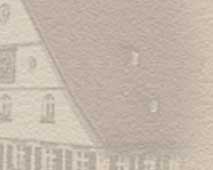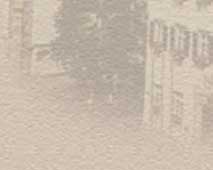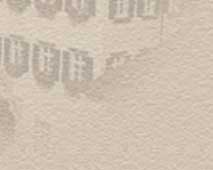|
Daß es dem Cannstatter - und selbstverständlich auch der Cannstatterin - an Selbstbewußtsein gebricht, wenn die Sprache auf seine Heimatstadt kommt, darf getrost in das Reich der Fabel verwiesen werden. Mit einem Wort: Er ist selbstbewußt und läßt dies einen auswärtigen gelegentlich auch ganz ungebremst merken. "Er gerät förmlich in Eifer", schrieb vor annähernd einhundert Jahren der Herausgeber der "Cannstatter Zeitung, C. H. Beck .... wenn frühere Verhältnisse der Stadt den Gegenstand der Unterhaltung bilden". Ein besonders scharf ausgeprägtes Gefühl, das dem Oberamtsstädter "zu allen Zeiten" eigen gewesen sei.
Doch was ist es nun, das den Sauerwasserstädter "so oiga" macht. An der Pracht mittelalterlicher Bauten kann es nicht liegen. Sicher, es gibt einige wichtige historische Bauzeugen, wie etwa die Stadtkirche von Aberlin Jörg mit dem Turm von Heinrich Schickhardt oder die schön geschwungene Marktstrasse mit ihren Giebelhäusern. Auch das Rathaus aus dem Jahre 1491 mit der zweitältesten Glocke Württembergs (nach 1200) darf dazu gerechnet werden. Aber insgesamt ist das Städtchen am Neckar, wie es in alten Beschreibungen aus dem sechzehnten Jahrhundert immer wieder heißt, "zum Gebrauch gebaut" gewesen.
Ja, wenn’s nicht das "alte Gemäuer" ist, das die Einwohner so stolz macht, was ist es dann?
Vor einigen Jahren beispielsweise wurden in den Steinbrüchen unweit des Neckar-Viadukts die nachweisbar ältesten menschlichen Werkzeuge gefunden. Geschätztes Alter 250 000 Jahre. Auf dem Steinhaldenfeld wurden in den 1930er Jahren die reich ausgestatteten hallstattzeitlichen Fürstengräber mit ihren reichen Goldfunden entdeckt und etwa um 90. nach Chr. erbauten die Römer ein Kastell auf der Altenburg. Hier oben entstand auch die Urkirche des Neckartals. Um 700 wurde Cannstatt erstmals in einer Urkunde des Klosters St. Gallen erwähnt und 1330 durch Kaiser Ludwig den Bayer mit Stadtrechten ausgestattet. Soviel stichwortartig zur Frühzeit.
So etwa um 1500 herum trat dann Cannstatt "faßbar" in die Geschichte ein. Der wirtschaftliche Aufstieg begann. Noch heute erinnert sich der Cannstatter, daß hier das Zentralpostamt der Thurn- und Taxis-Post - übrigens bis 1806 - ansässig war. Er erinnert sich daran, daß von 1713 bis etwa 1870, "sein" Cannstatt Hafenstadt war. Insbesondere beeindruckt ist er und kann sich eines gewissen sentimentalen Gefühls nicht erwehren, wenn die Rede auf die "große und unvergleichliche Zeit des Weltbads" kommt. Man bedenke, Kaiser, Könige und Fürsten stiegen hierorts ab. Es war die Zeit, in der am Wilhelmsplatz die erste Hautklinik Deutschlands gegründet wurde und gegenüber in der Badstrasse der Dr. Jakob von Heine als erster die Spinale Kinderlähmung als eigenständige Krankheit erkannt hat und die deshalb seit 1907 Heine-Medinsche Krankheit heißt. Und noch etwas weiteres macht stolz: Bad Cannstatt hat mit 19 Mineralquellen das größte Heilwasservorkommen in Westeuropa.
Hier in Bad Cannstatt fuhr 1845 die erste Eisenbahn Württembergs, hier erfanden Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach gemeinsam den schnellaufenden Benzinmotor, hier fuhr das erste Motorrad der Welt, hier wurden die erste Autogarage und die erste Tankstelle der Welt erbaut. Hier wurden aber auch so weltbedeutende Firmen wie beispielsweise Werner u. Pfleiderer gegründet und hier an den Ufern des Neckars "erfand" der Fabrikant Lindauer den ersten Büstenhalter der Welt.
König Wilhelm I und seine Gemahlin, die russische Großfürstentochter, Königin Katharina, machten mit dem 1818 gestifteten Cannstatter Volksfest den Namen Cannstatts auch drüben über dem "Großen Teich" bekannt.
Hier in Bad Cannstatt wurde der Schriftsteller Thaddäus Troll geboren, hier gingen der spätere Literaturwissenschaftler Max Kommerell, der Psychiater Ernst Kretschmar und der Dichter Hermann Hesse ebenso zur Schule, wie die Konstrukteure Ernst Heinkel, Ferry Porsche oder Hellmuth Hirth.
Versteht nunmehr ein "Fremder", warum die Cannstatter so stolz auf "ihr Cannstatt" sind?
"Ist das Stuttgart bei Cannstatt"? ließ der Landeshistoriker Johann Daniel Georg Memminger einen Polizeibeamten in Tirol in seiner "Geschichte von Cannstatt" anno 1812 fragen, als er dessen Paß kontrollierte. Es sei zwar eine "lächerliche Frage", meinte unser Gewährsmann Memminger, die von "wenigen geographischen Kenntnissen" zeuge, "aber desto mehr von dem Rufe der Stadt vornehmlich in den neuen Weltbegebenheiten". Und wenn dies der Begründer der modernen württembergischen Landesgeschichtsschreibung sagt, wer wollte ihm dann widersprochen?
Hans Otto Stroheker
|